Hinweis zur Aktualisierung
Dieser Beitrag wurde am 7. September 2025 zuletzt aktualisiert. Ergänzt wurden aktuelle Entwicklungen zur Kooperation von OpenAI und Broadcom, die gemeinsam eigene KI-Beschleuniger entwickeln. Ziel dieser Initiative ist es, strategische Unabhängigkeit von Nvidia zu gewinnen und durch spezialisierte Chips Energieeffizienz sowie Skalierbarkeit zu verbessern.
KI braucht Energie, und das nicht zu knapp
Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Sie automatisiert Prozesse, analysiert riesige Datenmengen in Sekundenbruchteilen und unterstützt kreative wie analytische Aufgaben mit bislang ungekanntem Tempo. Doch hinter den beeindruckenden Fähigkeiten moderner KI-Modelle verbirgt sich ein enormer Rechenaufwand – und der hat einen Preis: Energieverbrauch.
Ob beim initialen Training großer Sprachmodelle, bei der permanenten Bereitstellung in Rechenzentren oder bei alltäglichen Inferenzabfragen – jeder Schritt benötigt Rechenleistung in hohem Maßstab. Und damit verbunden: CO₂-Emissionen, die sich summieren. Ein einzelner Trainingslauf eines großen Modells kann rechnerisch den Jahresverbrauch eines mehrköpfigen Haushalts übersteigen.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach KI-Systemen rapide an – in Unternehmen, in der Wissenschaft und im Alltag. Damit wächst auch der Druck, diese Technologien nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten. Was bislang oft hinter verschlossenen Türen geschieht, rückt zunehmend in den Fokus von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
Mehr denn je braucht es verlässliche Metriken, nachvollziehbare Standards und globale Leitlinien, die den ökologischen Fußabdruck von KI-Systemen messbar und vergleichbar machen. Denn nur wer misst, kann auch steuern. Und nur wer offenlegt, kann verantwortungsvoll handeln.
Status Quo: KI und der ökologische Fußabdruck
Trotz aller Faszination für die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle bleibt eine zentrale Frage häufig unbeantwortet: Wie viel Energie verbraucht moderne KI eigentlich – und wie hoch ist ihr ökologischer Preis?
Der Boom generativer Modelle wie Claude 3, GPT-3 oder GPT-4 hat dazu geführt, dass Training und Nutzung solcher Systeme in einem bisher nie dagewesenen Maßstab stattfinden. Doch was in Sekundenbruchteilen Text generiert, basiert auf komplexen Rechenprozessen, die enorme Mengen an Strom benötigen – sowohl einmalig beim Training als auch dauerhaft bei der Inferenz.
Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die CO₂-Bilanzen ausgewählter Modelle, den Unterschied zwischen Trainings- und Inferenzphase und die Probleme bei der Messung und Vergleichbarkeit solcher Daten. Dabei zeigt sich schnell: Die Diskussion um Nachhaltigkeit in der KI steht erst am Anfang – und ist längst überfällig.
Vergleich: GPT-3 Trainingslauf vs. Haushalts-Emissionen
Ein oft zitierter Vergleich stammt aus einer Analyse der Columbia Climate School. Demnach verursachte der Trainingslauf des Sprachmodells GPT‑3 – mit seinen rund 175 Milliarden Parametern – schätzungsweise 1.287 Megawattstunden Stromverbrauch und rund 502 Tonnen CO₂‑Äquivalent. Das entspricht in etwa dem jährlichen CO₂‑Ausstoß von 112 konventionellen PKW.
Zum Vergleich: Ein einzelner europäischer Vier-Personen-Haushalt verursacht im Jahr etwa vier bis fünf Tonnen CO₂. Der Trainingslauf von GPT‑3 übersteigt diesen Wert also um das Hundertfache – eine Größenordnung, die den ökologischen Maßstab moderner KI-Modelle deutlich macht.
Bei neueren Modellen wie Claude 3 oder GPT‑4 ist von einem nochmals höheren Energiebedarf auszugehen, da sie mit noch mehr Parametern, größeren Trainingsdatensätzen und längeren Trainingszyklen arbeiten. Zwar werden heute effizientere Chips und optimierte Trainingsverfahren eingesetzt, doch der Trend zu immer größeren Modellen lässt vermuten, dass der ökologische Fußabdruck auch künftig beträchtlich bleibt – wenn nicht aktiv gegengesteuert wird.
Energiebedarf von LLMs: Training versus Inferenz und Modellgröße
Auch wenn das Training großer Modelle extrem ressourcenintensiv ist – bei regelmäßigem Einsatz überwiegt die Inferenz: Google schätzt, dass etwa 60 % der Energie im Lebenszyklus eines Sprachmodells auf den Betrieb (Inference), nicht den Trainingsprozess entfalle.
Beispielsweise erzeugt eine einzelne 400‑Token‑Antwort des Modells Le Chat (Mistral Large 2) lediglich 1,14 g CO₂ und verbraucht ca. 45 ml Wasser und 0,16 mg an seltenen Erden (Antimon‑Äquivalente). Trotzdem summiert sich dieser Fußabdruck bei Millionen Abfragen – und kann den Trainingsanteil bald erreichen oder übersteigen.
Ein entscheidender Faktor: die Modellgröße skaliert linear mit dem ökologischen Fußabdruck. Ein zehnfach größeres Modell verursacht in etwa zehnmal so viele Emissionen – das betrifft sowohl CO₂, Wasserverbrauch als auch Materialressourcen.
Während sich der Energiehunger von GPUs wie Nvidias H100 kaum leugnen lässt, gehen Anbieter inzwischen neue Wege. So arbeitet OpenAI gemeinsam mit Broadcom an einem eigenen KI-Beschleuniger, der nicht nur strategische Unabhängigkeit schaffen, sondern auch eine deutlich höhere Energieeffizienz ermöglichen soll. Maßgeschneiderte Chips können spezifische Workloads zielgerichteter bedienen und den Stromverbrauch pro Modellabsicherung senken.
Herausforderungen der Messbarkeit
Die Vergleichbarkeit von Umweltbelastungen stößt auf mehrere Probleme:
- Lebenszyklusanalysen fehlen oft oder basieren auf nicht standardisierten Methodiken: etwa fehlen Angaben zur Herstellung von Hardware (Transport, Fertigung, Entsorgung), oder es mangelt an offenen Peer-Reviews der Umweltbewertungen.
- Regionale Unterschiede im Strommix (erneuerbare Energie versus fossile Quellen) beeinflussen CO₂-Bilanzen stark.
- Unklare Zuordnung von Trainings‑ und Inferenzkosten erschwert eine belastbare Analyse – viele Anbieter bündeln Emissionen zwar, machen aber keine separat ausgewiesene Transparenz möglich.
Zusammenfassung in Stichpunkten
- Einzelne Trainingsläufe: mehrere hundert oder tausend Tonnen CO₂, enorme Mengen Wasser und seltene Ressourcen.
- Inferenzverbrauch wächst: bei hoher Nutzung dominierend, auch bei geringem Einzelfootprint pro Anfrage.
- Skalierer Effekt Modellgröße: größere Modelle verursachen linear mehr Impact.
- Messbarkeit limitiert: fehlende Standards, regionalspezifische Unterschiede, intransparente Methodik.
Was Mistral AI fordert – und warum es relevant ist
Angesichts wachsender Kritik an der Intransparenz und Umweltbelastung großer KI-Modelle geht das französische Unternehmen Mistral AI nun einen konkreten Schritt: Es schlägt erstmals ein offenes System zur standardisierten Erfassung und Veröffentlichung von Umweltkennzahlen für KI-Systeme vor.
Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck von KI-Modellen nicht länger als internes Betriebsgeheimnis zu behandeln, sondern ihn vergleichbar, überprüfbar und nachvollziehbar zu machen – über Anbietergrenzen hinweg.
Kernpunkte des Vorschlags:
- Angabe der CO₂-Emissionen pro generiertem Token: Die Umweltwirkung soll auf Mikroebene messbar werden – konkret: Gramm CO₂-Äquivalent pro Token, getrennt für Training und Inferenz. Auch Material- und Wasserverbrauch werden in Relation zum Token-Ausstoß angegeben.
- Lebenszyklus-Betrachtung: Neben dem laufenden Betrieb sollen auch Vor- und Nachgelagerte Emissionen – etwa durch Hardwareherstellung, Transport oder Entsorgung – berücksichtigt werden.
- Unterscheidung zwischen Training und Inferenz: Beide Phasen sollen separat ausgewiesen werden, da sie unterschiedliche Ressourcen beanspruchen und über den Lebenszyklus eines Modells hinweg unterschiedlich gewichtet sind.
- Zusätzliche Angaben zu Recheninfrastruktur: Dazu gehören der Standort des Rechenzentrums, der verwendete Strommix, die Art der Hardware (z.B. GPU- oder TPU-Cluster), sowie Angaben zu Kühlung und Effizienzmaßnahmen.
Dieser Vorstoß ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Erstens bietet er eine konkrete methodische Grundlage, auf der sich Umweltbilanzen nicht nur berechnen, sondern auch vergleichen lassen. Zweitens schafft er Anreize für Anbieter, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen – etwa bei Standortwahl, Modellarchitektur oder Energieversorgung.
Drittens adressiert er eine Leerstelle, die in der bisherigen Diskussion oft nur oberflächlich behandelt wurde: Die Frage nach der Verantwortlichkeit für die versteckten Umweltkosten intelligenter Systeme.
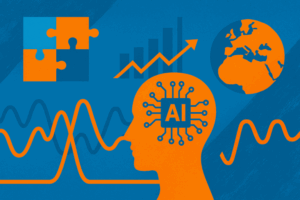
Exkurs: Warum es (noch) keine einheitlichen Standards gibt – und wer davon profitiert
Der Vorschlag von Mistral AI wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf ein grundlegendes Problem der Branche: Bislang existieren keine verbindlichen, international anerkannten Standards, um den Energie- und Ressourcenverbrauch von KI-Anwendungen zu dokumentieren. Zwar gibt es einzelne Nachhaltigkeitsberichte großer Cloudanbieter, doch diese sind häufig unvollständig, methodisch uneinheitlich oder nicht auf Modell- und Anwendungsebene heruntergebrochen.
Die Gründe dafür sind vielfältig:
- Fehlende regulatorische Vorgaben: Während andere Branchen bereits verpflichtende CO₂-Reportingstrukturen haben, ist der KI-Sektor davon bislang ausgenommen
- Komplexität und Fragmentierung: Unterschiedliche Infrastrukturen, Stromquellen, Softwareoptimierungen und Modellvarianten erschweren standardisierte Vergleiche
- Strategische Zurückhaltung: Für manche Anbieter ist die Intransparenz ein Schutzschild – sie erlaubt es, Nachhaltigkeitsaspekte marketingwirksam zu präsentieren, ohne reale Messgrößen offenlegen zu müssen
In einem Umfeld ohne klare Standards ist es schwer, Greenwashing von echten Fortschritten zu unterscheiden. Umso wichtiger ist es, dass Initiativen wie jene von Mistral AI nun öffentlich diskutiert und idealerweise gemeinsam weiterentwickelt werden.
Der Standpunkt der Wissenschaft – Nature über Messbarkeit und Lücken
Während erste Unternehmen wie Mistral konkrete Vorschläge zur Umweltbilanzierung von KI-Modellen vorlegen, kommt auch aus der Wissenschaft zunehmend Rückenwind – und zugleich Kritik. In einem im Juli 2025 veröffentlichten Kommentar im Fachmagazin Nature fordern internationale Forscher:innen ein offenes, standardisiertes und überprüfbares Reporting-System für den ökologischen Fußabdruck von KI.
Zwar erkennen die Autor:innen an, dass die Rechenlast in der KI-Entwicklung enorme Fortschritte ermöglicht hat, weisen jedoch deutlich auf die systematischen Lücken in der Dokumentation und Offenlegung hin. Ein zentrales Problem: Bislang fehlt es an einer allgemein akzeptierten Methodik zur Bewertung und Veröffentlichung von Umweltkennzahlen für KI-Modelle.
Drei zentrale Kritikpunkte:
- Intransparente Datenlage
Viele Anbieter machen keine detaillierten Angaben zum Energieverbrauch oder verweisen lediglich auf allgemeine Nachhaltigkeitsziele. Die Nachvollziehbarkeit leidet – und damit auch die Glaubwürdigkeit. - Inkonsistente Berechnungsmethoden
Es gibt derzeit keinen einheitlichen Rahmen für die Erhebung und Darstellung von Umweltmetriken. Je nach Anbieter, Standort oder Hardwarekonfiguration weichen die Berechnungsgrundlagen erheblich voneinander ab. - Fehlende Rechenschaftspflicht großer Akteure
Die Autor:innen nehmen insbesondere marktführende Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft und OpenAI in die Pflicht. Als Betreiber globaler Rechenzentren und Entwickler leistungsstarker KI-Systeme tragen sie eine besondere Verantwortung für Transparenz – und sollten diese offen einlösen.
Die Forderung: ein KI-spezifisches Umweltreporting
Die Wissenschaft schlägt vor, Umweltkennzahlen künftig modellbezogen, lifecycle-orientiert und öffentlich zugänglich zu machen. Dabei sollten nicht nur Trainingsdaten, sondern auch die Inferenzleistung, der Energieverbrauch pro Anwendung und die verwendete Infrastruktur dokumentiert werden – idealerweise nach dem Vorbild von Umweltdeklarationen in anderen Industriezweigen.
Zudem sprechen sich die Autor:innen für eine Verankerung solcher Kennzahlen in Förderbedingungen, Zertifizierungsprozessen und regulatorischen Rahmenwerken aus. Nur wenn die ökologische Dimension von KI von Anfang an mitgedacht wird, könne nachhaltige Innovation wirklich gelingen.
Wer macht was? Überblick über aktuelle Ansätze großer KI-Anbieter
Auch wenn einheitliche Standards bislang fehlen, gibt es durchaus Anbieter, die erste Schritte in Richtung Transparenz unternehmen. Die öffentlich zugänglichen Informationen sind jedoch uneinheitlich, oft fragmentarisch und selten auf Modell- oder Anwendungsebene heruntergebrochen.
Der folgende Überblick zeigt beispielhaft, wie vier prominente Akteure – Google DeepMind, Microsoft, Mistral und OpenAI – derzeit mit der Frage nach Umweltmetriken umgehen:
|
Anbieter |
Ökobilanz verfügbar? |
Umweltstrategie sichtbar? |
Transparente Metrik vorhanden? |
|
Google DeepMind |
Ja (stellenweise) |
Ja |
Teilweise |
|
Microsoft |
Ja (regional) |
Ja (Nachhaltigkeitsziele) |
Nein |
|
Mistral AI |
Ja |
Ja |
Ja (Token-basierte Metriken) |
|
OpenAI |
Teilweise |
Ja |
Nein |
Einordnung
- Google DeepMind integriert Nachhaltigkeitsüberlegungen in seine Forschungsagenda und verweist auf Maßnahmen zur Energieoptimierung. In Pilotprojekten wurden erste Umweltauswertungen veröffentlicht – allerdings ohne standardisierte Vergleichswerte.
- Microsoft verfolgt umfassende Klimaziele auf Unternehmensebene – darunter die Ambition, bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften. Der Strommix von Rechenzentren wird teilweise regional ausgewiesen, doch konkrete Angaben auf Modell- oder Serviceebene fehlen.
- Mistral AI geht am weitesten: Das Unternehmen hat eine detaillierte Lebenszyklusanalyse des eigenen Modells veröffentlicht, inklusive CO₂-Ausstoß, Wasserverbrauch und Ressourcennutzung pro generiertem Token – getrennt nach Training und Inferenz.
- OpenAI verweist in Interviews und technischen Berichten gelegentlich auf Energieeffizienz, veröffentlicht jedoch keine konsistenten Zahlen zum CO₂-Ausstoß einzelner Modelle. Die interne Strategie zur Optimierung bleibt damit weitgehend intransparent.
Fazit
Während viele Anbieter Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene thematisieren, fehlt es auf der Ebene konkreter KI-Modelle meist an verbindlicher Transparenz. Nur Mistral geht bisher den Schritt, Umweltkennzahlen nach einem klaren System offenzulegen und zur Diskussion zu stellen. Damit setzt das Unternehmen nicht nur ein wichtiges Signal, sondern liefert auch eine methodische Grundlage für den nächsten Schritt: regulierte Nachweispflichten und Vergleichbarkeit.
Warum es mehr braucht als freiwillige Initiativen
Die bisherigen Bemühungen einzelner Anbieter, Umweltkennzahlen offenzulegen, sind ein wichtiger erster Schritt. Doch sie bleiben freiwillig, uneinheitlich und nicht überprüfbar. Ohne verpflichtende Vorgaben besteht das Risiko, dass Unternehmen vor allem eines optimieren: ihre Außendarstellung. Das eigentliche Ziel – nachhaltige KI-Entwicklung – gerät dabei leicht in den Hintergrund.
Greenwashing durch Intransparenz
In einem Umfeld ohne belastbare Standards fällt es schwer, ernst gemeintes Umweltengagement von strategischem Marketing zu unterscheiden. Wenn Anbieter lediglich ausgewählte Metriken veröffentlichen – etwa zur Nutzung erneuerbarer Energien – aber gleichzeitig zentrale Verbrauchszahlen ausklammern, entsteht ein verzerrtes Bild. Greenwashing ist in solchen Fällen nicht nur möglich, sondern systembedingt begünstigt.
Unterschiedliche Interessen: Forschung, Unternehmen, Regulierungsbehörden
Ein weiteres Hindernis: Die beteiligten Akteure verfolgen teils konträre Ziele:
- Forschende fordern offene Daten und messbare Standards – für Vergleichbarkeit und wissenschaftliche Analyse.
- Regulierungsbehörden hingegen befinden sich oft noch in der Definitionsphase geeigneter Leitlinien und Rechtsrahmen.
- Unternehmen fürchten um Wettbewerbsvorteile und meiden zu tiefe Einblicke in interne Infrastrukturen.
Ohne politische Rahmensetzung fehlt es der Branche an Orientierung. Der Appell an die Eigenverantwortung bleibt wirkungslos, solange keine verbindlichen Maßstäbe gelten.
Vergleich mit anderen Industrien
Ein Blick in andere Branchen zeigt: Transparenz ist keine Utopie, sondern gelebte Praxis. Die Automobilindustrie etwa unterliegt strengen Vorschriften zur Emissionsmessung – einschließlich standardisierter Testzyklen und Prüfverfahren. Auch in der Energie- oder Bauwirtschaft haben sich Lebenszyklusanalysen und Umweltdeklarationen etabliert.
Warum also nicht auch bei KI? Die zugrunde liegende Technologie mag komplex sein – doch die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft sind real und messbar. Was fehlt, ist nicht das Wissen, sondern der politische Wille zur Umsetzung.

Exkurs: Welche Rolle spielen Zertifizierungsstellen wie ISO oder Green Software Foundation?
In der Debatte um Umweltstandards für KI rücken auch etablierte Institutionen in den Fokus. Organisationen wie die ISO (International Organization for Standardization) oder die Green Software Foundation könnten künftig eine zentrale Rolle spielen – etwa bei der Entwicklung und Prüfung von Kriterien für KI-spezifische Nachhaltigkeitslabels.
Erste Schritte in diese Richtung sind bereits erkennbar:
- Die Green Software Foundation arbeitet an Metriken zur Berechnung der Energieeffizienz von Software und Infrastruktur.
- Die ISO wiederum bietet mit Normen wie ISO 14040 und ISO 50001 methodische Grundlagen für Umweltmanagement und Energieeffizienz.
Entscheidend wird sein, ob diese Ansätze auf KI-Systeme übertragbar sind – und ob sie in künftige gesetzliche Rahmenwerke aufgenommen werden. Denn ohne unabhängige Kontrolle und externe Zertifizierungsmechanismen bleibt Nachhaltigkeit im KI-Bereich ein weitgehend freiwilliges Versprechen.
Wege zur Verbesserung: Was getan werden kann – und muss
Der ökologische Fußabdruck moderner KI ist kein Schicksal, sondern eine Gestaltungsfrage. Es gibt bereits heute eine Vielzahl von Hebeln, um den Ressourcenverbrauch von KI-Systemen zu senken – auf technischer, strategischer und politischer Ebene. Entscheidend ist, dass diese Möglichkeiten nicht nur diskutiert, sondern auch konsequent umgesetzt werden.
Technische Ansätze: Weniger ist mehr
- Batching und Lastverteilung
Intelligente Abfragesteuerung und optimiertes Ressourcenmanagement helfen, Rechenleistung besser auszunutzen. So können Anfragen gebündelt, Latenzzeiten reduziert und Leerlaufzeiten minimiert werden. - Modellkomprimierung und Quantisierung
Durch gezielte Reduktion der Modellgröße – etwa durch das Entfernen redundanter Parameter oder das Verwenden geringerer numerischer Präzision – lassen sich erhebliche Einsparungen beim Rechenaufwand erzielen. Kleinere, effizientere Modelle benötigen weniger Speicher, verbrauchen weniger Energie und sind schneller in der Ausführung. - Spezialisierte Hardware
Der Einsatz von KI-optimierten Chips wie Tensor Processing Units (TPUs) oder ASICs kann die Effizienz im Vergleich zu klassischen GPUs deutlich steigern. Diese Hardwarelösungen sind speziell auf KI-Berechnungen ausgelegt und bieten eine bessere Performance pro Watt.
Strategische Stellschrauben: Standort, Infrastruktur, Energiequellen
- Grünstromverträge und CO₂-Kompensation
Der Bezug zertifizierten Ökostroms oder die Beteiligung an CO₂-Kompensationsprojekten kann kurzfristig dazu beitragen, die Umweltbilanz zu verbessern. Langfristig müssen diese Maßnahmen jedoch durch strukturelle Effizienzgewinne ergänzt werden. - Kühltechnologien optimieren
Ein beträchtlicher Teil des Energieverbrauchs in Rechenzentren entfällt auf Kühlung. Moderne Kühlsysteme – etwa Freikühlung, Flüssigkühlung oder Wärmerückgewinnung – können hier signifikante Verbesserungen erzielen. - Rechenzentrumsstandorte gezielt wählen
Der CO₂-Fußabdruck hängt maßgeblich vom regionalen Strommix ab. Rechenzentren in Regionen mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien verursachen deutlich geringere Emissionen – ein wesentlicher Faktor bei der Planung global verteilter KI-Dienste.
Politische Impulse: Von der Empfehlung zur Verpflichtung
- ESG-Reporting für KI-Produkte verankern
Im Rahmen von ESG-Berichtspflichten (Environmental, Social, Governance) sollten auch KI-Systeme künftig mit standardisierten Nachhaltigkeitskennzahlen versehen werden – ähnlich wie bei Finanzberichten oder Produktdeklarationen. - Förderprogramme an Nachhaltigkeit koppeln
Öffentliche Forschungs- und Innovationsförderung könnte gezielt an ökologische Kriterien gebunden werden – etwa durch Bonuspunkte für energieeffiziente Modellarchitekturen oder nachhaltige Deployment-Strategien. - Regulatorische Standards entwickeln
Langfristig braucht es verbindliche Rahmenwerke auf nationaler und internationaler Ebene. Diese könnten beispielsweise Mindestanforderungen an die Umweltbilanz, Zertifizierungspflichten oder Transparenzvorgaben definieren – analog zu bestehenden Normen in anderen Industriezweigen.
Fazit – Intelligente Systeme brauchen verantwortungsvolle Grundlagen
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – wirtschaftlich, gesellschaftlich und technologisch. Doch während der Fokus oft auf Effizienz, Automatisierung und Innovation liegt, wird eine zentrale Dimension bislang zu wenig beachtet: die ökologische Verantwortung. Jede Trainingsstunde, jede Token-Ausgabe, jede Inferenzanfrage hat ihren Preis – in Form von Energieverbrauch, Ressourcenbindung und CO₂-Emissionen.
KI ist nicht neutral. Sie basiert auf Infrastrukturen, die Strom benötigen, Wärme erzeugen und seltene Materialien verbrauchen. Solange diese Auswirkungen nicht systematisch erfasst, bewertet und offen kommuniziert werden, bleibt Nachhaltigkeit im KI-Kontext eine leere Worthülse.
Standardisierung ist kein Hindernis, sondern eine Voraussetzung für Fortschritt. Nur wenn Anbieter, Forschende und Regulierungsbehörden auf gemeinsame Metriken und transparente Nachweise setzen, kann ein echter Vergleich entstehen – und mit ihm Anreize für Verbesserung. Die Vorschläge von Mistral AI und die Forderungen der Wissenschaft zeigen: Der Weg dorthin ist machbar.
Zudem darf Nachhaltigkeit nicht als Zusatz verstanden werden, sondern als ethische Grundlage digitaler Innovation. Wer KI in den Dienst der Gesellschaft stellen will, muss auch Verantwortung für ihre ökologischen Grundlagen übernehmen.
Quellenverzeichnis
(Abgerufen am 28.07.2025)
- Mistral AI: Our contribution to a global environmental standard for AI
- Nature: AI’s environmental impact demands open standards
- Columbia Climate School: AI’s Growing Carbon Footprint
- Digit: Mistral AI Study Highlights the Environmental Impact of LLMs
- LinkedIn: Beiträge von Cam Pedersen und Sasha Luccioni zu Mistral AI
- Gigazine: Mistral AI releases detailed environmental impact of its models
- Wikipedia: Environmental impact of artificial intelligence
Eigene Beiträge mit thematischem Bezug:
